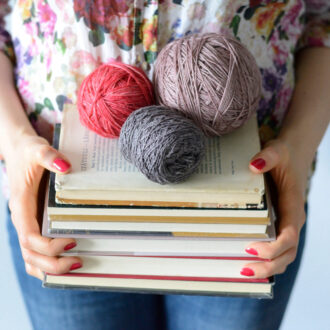Die Allee zu einem Holzgebäude ist von Kiefern gesäumt. Ein traditioneller, nicht gestrichener Zaun bildet einen Platz hinter den Bäumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Orten soll der Zaun hier nicht Rentiere fernhalten. Er dient vielmehr dazu, etwas einzufangen, was mit bloßem Auge nicht immer erkennbar ist.
Auch das Aussehen der Gebäude ist irreführend. Am Sodankylä Geophysical Observatory (SGO) arbeiten über vierzig Personen, Wissenschaftler und Ingenieure aus der ganzen Welt. Gemeinsam wollen sie etwas verstehen, was für uns Menschen nur am dunklen Polarhimmel sichtbar ist: die Nordlichter.
Eija Tanskanen, Direktorin der SGO, untersucht seit mehr als 30 Jahren die Nordlichter und magnetischen Störungen in der Atmosphäre.
Als Kind legte sie sich in den Schnee und fragte sich, was die Nordlichter eigentlich sind. Bevor sie sich in Sodankylä niederließ, arbeitete Tanskanen in verschiedenen Forschungs-, Lehr- und Managementpositionen, unter anderem am NASA Goddard Space Flight Center (NASA/GSFC).
Seit dem Beginn von Tanskanens Karriere hat die Wissenschaft große Fortschritte gemacht, von denen wir alle profitieren. Die Riesenfortschritte in der Navigationstechnologie – bei Kompassen und Flugzeugen – sind auf das zunehmende Wissen über Magnetfelder und Störungen zurückzuführen.
„Wir verstehen die Atmosphäre jetzt viel besser“, sagt Tanskanen.
Das Verstehen der Nordlichter ist eng mit dem Verständnis von Magnetfeldern verbunden. Das Polarlicht entsteht etwa 100 Kilometer über dem Boden, also in der oberen Atmosphäre, wenn der Sonnenwind magnetische Stürme zur Erde trägt. Die Lichter folgen den Magnetfeldern der Erde. In den nördlichen Regionen nennt man sie Aurora Borealis, in südlichen Regionen Aurora Australalis.
Was sehen die Vögel?
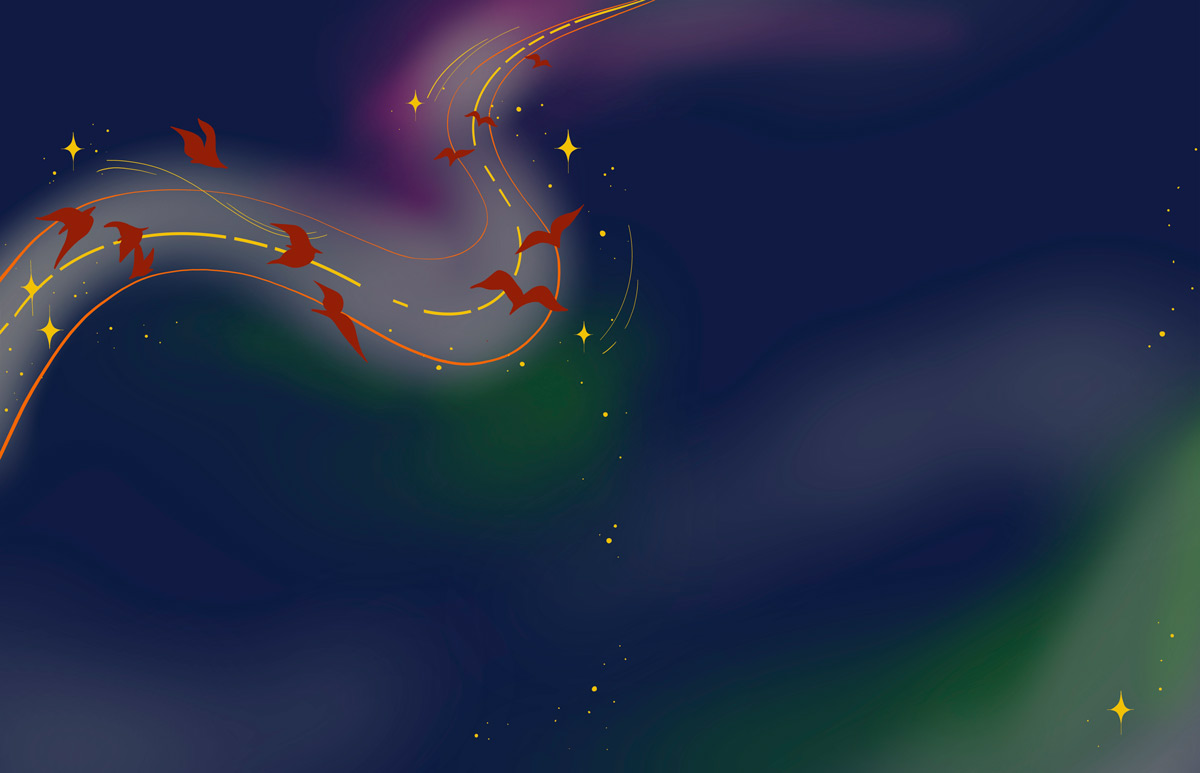
Illustration: Annu Kilpeläinen
Tanskanen geht den Sandweg außerhalb des Observatoriums entlang. Sie blickt immer wieder nach oben, damit sie den Himmel sehen kann. Den Blick in Richtung Weltraum werfen, das macht Taskanen schon lange.
Für ihre Doktorarbeit untersuchte Tanskanen den Energiehaushalt der Sonne, oder, wie sie es praktischer ausdrückt, „woher das Polarlicht seine Energie bezieht.“
Das 120 Kilometer nördlich des Polarkreises in Finnisch-Lappland gelegene Observatorium Sodankylä dient seit 1914 als Basis für wissenschaftliche, geophysikalische Messungen.
Heute ist das Observatorium eine unabhängige Forschungsabteilung der Universität Oulu. Von Anfang an wurden hier die Magnetfelder der Erde gemessen.
„Alles, was mit Navigation und Orientierung zu tun hat, wie Flugzeuge und Kompasse, basiert auf der Messung von Magnetfeldern“, erläutert Tanskanen.
Die Magnetpole sind Orte, an denen die Magnetfelder senkrecht zueinander stehen. Die Erde hat zwei Magnetpole: einen im Norden und einen im Süden. Die Nordlichter sind für das menschliche Auge nur in der Nähe der Magnetpole sichtbar, wenn ein Sonnensturm auf den Planeten trifft. Zugvögel nutzen Magnetfelder zur Navigation. Sie können die Magnetfelder sehen, so wie wir Menschen Straßen sehen können.
Polarexpeditionen stehen bevor

Sodankylä bietet die idealen Bedingungen für die Erforschung des Polarlichts, sagt Eija Tanskanen.Fotografie: Sabrina Bqain
Die geophysikalische Wissenschaftsgemeinde hat ein Problem. Die Positionen der Magnetpole sind in ständiger Bewegung, und ihre genauen geografischen Punkte sind derzeit nicht bekannt. Sie entsprechen nicht den geografischen Polen und dürften derzeit etwa 500 Kilometer voneinander entfernt liegen.
Die unzureichende Kenntnis über die Position der magnetischen Pole führt zu Ungenauigkeiten bei der Navigation, insbesondere in den Polargebieten.
„Wir wissen, dass der magnetische Nordpol Ende des letzten Jahrhunderts die kanadische Inselgruppe verlassen hat und sich irgendwo im Arktischen Ozean in Richtung Sibirien bewegt“, sagt Tanskanen.
Die Lösung des Problems ist, sich auf die Suche nach den wandernden Magnetpolen zu machen. Im September 2025 wird sich eine Polarexpedition von Sodankylä aus auf den Weg zu einem unbekannten Ort irgendwo in der Mitte des Nordpolarmeeres machen, um den magnetischen Nordpol der Erde zu finden.
Eine ähnliche Reise in den Süden wird im Februar 2026 stattfinden.
„Die Forscher wissen weder, wo der Pol liegt, noch wie die Bedingungen sein werden.“
Sie müssen möglicherweise Ski fahren oder sogar schwimmen, um den Pol zu erreichen. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, den genauen Standort des Pols zu finden. Die Forscher müssen vom Rande der Welt aus auch den Rest der Welt irgendwie über den Standort in Kenntnis setzen.
„Wir wissen noch nicht, wie wir das machen werden“, sagt Tanskanen.
Sicher ist jedoch, dass die wichtigste Ausrüstung für diese Expeditionen hier in Sodankylä hergestellt wird. Ein spezieller, kugelförmiger Kompass, der genau auf die Position des Magnetpols zeigt, um nur ein Gerät zu nennen.
Verbunden mit dem Universum
Auf dem Gelände des Observatoriums sind Magnetometer in roten Hütten untergebracht, die die Größe, Kraft und Richtung der Magnetfelder messen. Sie verbinden Sodankylä mit der Welt.
„Eigentlich mit dem ganzen Universum“, korrigiert Tanskanen.
Hier geht die Sonne im Sommer nie unter, im Winter dagegen gib es nur wenige Stunden Tageslicht. Diese extremen Lichtverhältnisse machen Sodankylä und die Region Lappland zu einem ausgezeichneten Reiseziel für Nordlicht-Jäger, aber auch zu einem idealen Ort für geophysikalische Forschung.
„Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, warum wir Wissenschaft in der Wildnis betreiben wollen, antworte ich, dass diese Art von Wissenschaft an einem Ort betrieben werden muss, an dem man die Stimmen der Natur besser hören kann als die Stimmen der Menschen“, sagt Tanskanen.
Gute Jahre liegen vor uns
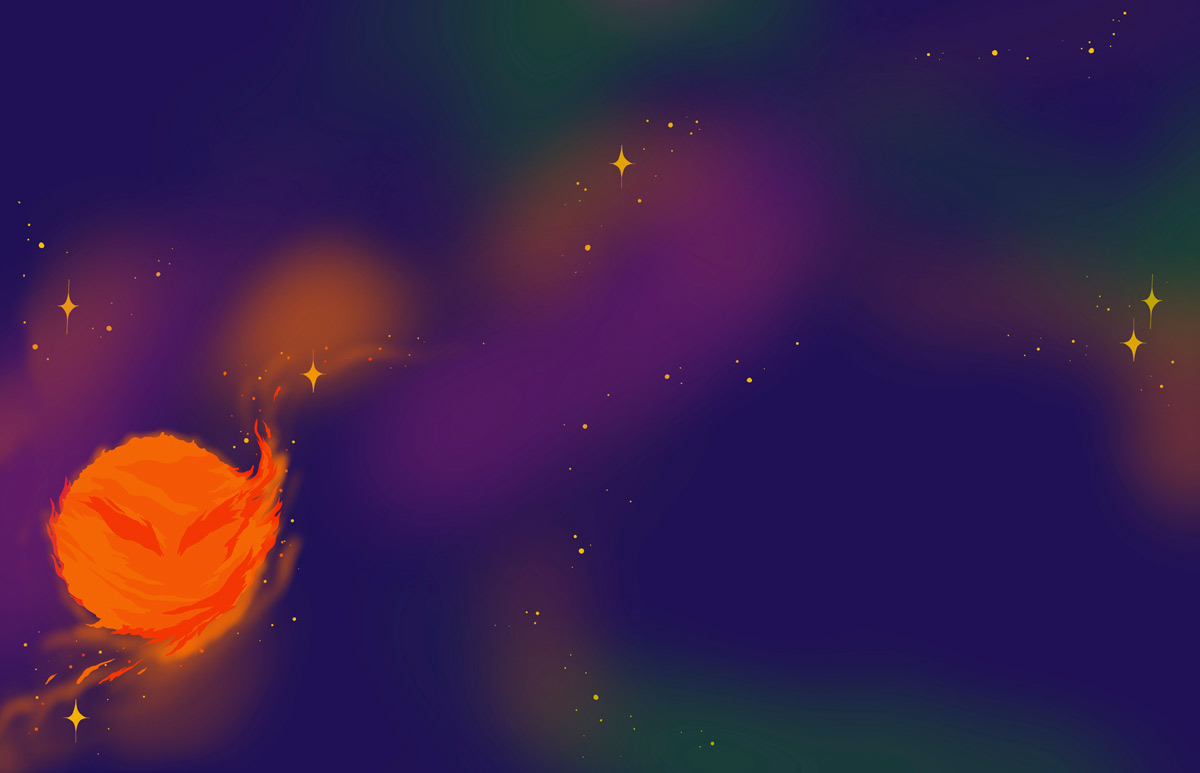
Illustration: Annu Kilpeläinen
Tanskanen hat fantastische Neuigkeiten für alle, die davon träumen, die Nordlichter zu sehen: Ab 2025 wird die Anzahl der Nordlichter bis 2028 zunehmen.
Der Grund dafür ist, dass die Sonne ein zorniges Gesicht bekommt. Das klingt bedrohlicher als es ist, erklärt Tanskanen.
Der Sonnenzyklus hat den Punkt erreicht, an dem sich große Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche befinden. Ein Sonnenfleck kann so groß sein wie der Planet Jupiter.
„Die Sonneneinstrahlung ist zyklisch. Der bekannteste Zyklus beträgt 11 Jahre, ein anderer 22 Jahre. Der Nordpol und der Südpol der Sonne wechseln alle 11 Jahre ihren Platz, sodass alle 22 Jahre der Norden im Norden und der Süden im Süden ist.“
Tanskanen zeigt ein Bild: Zu Beginn eines jeden Zyklus ist die Sonne mehr oder weniger gleichmäßig gelb. Um die Jahre 4 und 5 des Zyklus herum bekommt die Oberfläche viele kleine Punkte.
„Es ähnelt dem Moment, kurz bevor das Wasser in einem Topf zu kochen beginnt und man viele kleine Blasen am Boden des Topfes sieht“, erläutert sie.
2025 bewegen wir uns um diesen Punkt. Die Sonne beginnt zu kochen, und die kleinen Sonnenflecken blubbern, und einige Blasen platzen aus der Sonne heraus. Wenn sie auf die Atmosphäre und das Magnetfeld der Erde um den Nord- und Südpol treffen, zeigen sich die Nordlichter.
2025 sind die Nordlichter voraussichtlich eher schlicht und grün. Zwischen 2026 und 2028, also in den Jahren 6 und 7 des Sonnenzyklus, erreicht die Zahl der Sonnenflecken ihren Höhepunkt.
Dann beginnen die Stürme erst so richtig, sagt Tanskanen.
„Und dann sagen wir, die Sonne trägt ein zorniges Gesicht. Es sieht aus, als würde sie Grimassen schneiden. Zu diesem Zeitpunkt wird es mehr Nordlichter geben, mit komplexeren Formen und Farben wie Rot und Blau.“
Finnische Weltraumtechnologie- und Explorationsunternehmen, die man im Auge behalten sollte
Huld ist ein Technologie- und Designunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Software für die anspruchsvollsten Weltraummissionen unter der Leitung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).
ICEYE Die SAR-Satellitenkonstellation (Synthetic Aperture Radar) dieses Unternehmens ermöglicht ihm die Bereitstellung von Informationen für Bereiche wie Reaktion auf Naturkatastrophen und deren Bewältigung, Sicherheit, Meeresüberwachung, Versicherungen und Finanzen.
Kuva Space baut ein umfangreiches Hyperspektralsatelliten-Cluster auf und nutzt fortschrittliche KI, um seinen Kunden weltraumgestützte Erkenntnisse nahezu in Echtzeit zu liefern.
ReOrbit bietet softwaredefinierte Satelliten. Sie bieten einsatzbereite Raumfahrtsysteme und Avionik für flexible und zeitnahe Missionen auf jeder Umlaufbahn.
Solar Foods züchtet ein Allzweckprotein namens Solein aus unserer Atemluft. 2024 gewann Solar Foods die internationale Kategorie beim NASA Deep Space Food Challenge, bei dem Innovationen für die Ernährung von Astronauten auf langen Weltraummissionen gesucht werden.
Text Anna Ruohonen, ThisisFINLAND Magazine